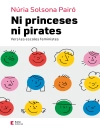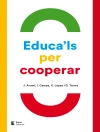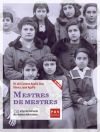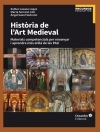Für einen erfolgreichen Wirtschaftsunterricht
Lehrkräfte und Studierende der ökonomischen Bildung können die Herausforderungen eines modernen Wirtschaftsunterrichts an allgemeinbildenden Schulen nur bewältigen, wenn sie sich auf verlässliche fachdidaktische Grundlagen stützen können.
Hans Kaminskis Werk führt zuverlässig in wichtige Kernbereiche der Fachdidaktik ökonomischer Bildung ein.
Darüber hinaus erhalten Leser praktische Hinweise für die Unterrichtsplanung und Gestaltung.
Mục lục
Einführung und Vorwort 14
Danksagung 18
1. Aufgaben einer Fachdidaktik der ökonomischen Bildung 21
1.1 Der Alltag 22
1.2 Aufgaben eines Lehrers aus fachdidaktischer Sicht 23
1.3 Zusammenfassung 26
2. Ökonomische Bildung als bildungstheoretische Herausforderung: Warum ökonomische Bildung? 29
2.1 Bildungsverständnis 31
2.2 Bildung – ein dynamischer Begriff 38
2.3 Zusammenfassung 39
3. Historische Entwicklungslinien der ökonomischen Bildung in Deutschland 43
3.1 Vom Nutzen der Betrachtung historischer Entwicklungsverläufe schulischer Domänen 44
3.2 Der Weg von der Industrieschulbewegung zur Arbeitslehrebewegung im 20. Jahrhundert 48
3.2.1 Ausgangspunkt: Die Industrieschulbewegung im 18. Jahrhundert 48
3.2.2 Modell der Arbeitslehre des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen (1964) 50
3.2.3 Bundeslandspezifische Entwicklungen der Arbeitslehre 55
3.3 Exkurs: Ansätze einer integrativen Arbeitslehre 59
3.4 Die ökonomisch-technische Bildung in der Transformationszeit 1989ff 64
3.4.1 Diskussion um eine „revidierte“ polytechnische Bildung und Erziehung
in den 1990er-Jahren – Der Grundgedanke der polytechnischen Bildung und Erziehung 65
3.4.2 Bundeslandspezifische Fach(-bereichs)bezeichnungen 70
3.5 Zusammenfassung 70
4. Die Entwicklung eines Referenzsystems für die ökonomische Bildung 75
4.1 Zur Funktion von Schulfächern und Lehrplänen 77
4.2 Referenzsysteme als Suchraster für Ziel-Inhalts-Systeme (Schulfächer) 79
4.3 Referenzsysteme für die ökonomische Bildung im allgemeinbildenden Schulsystem 83
4.3.1 Herausforderungen für die Bestimmung von Zielen und Inhalten der ökonomischen Bildung 83
4.3.2 Vom Relevanzproblem zum Referenzsystem 85
4.4 Wirtschaftswissenschaftliches Grundverständnis und die Entwicklung von Referenzsystemen 97
4.4.1 Theoriekomplexe der Ökonomik 97
4.4.2 Unterschiedliche Logiken von Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft: die funktionelle Differenzierung 105
4.4.3 Neue Institutionenökonomik 109
4.4.4 Fachdidaktische Folgerungen 119
4.5 Referenzsysteme und das Verhältnis von Fachwissenschaft und Fachdidaktik 121
4.6 Fachdidaktische Ordnungsversuche 125
4.6.1 Die didaktische Bedeutung des Ordnens 125
4.6.2 Didaktische Ordnungsversuche 129
4.7 Ein Kompetenzgefüge für die ökonomische Bildung im allgemeinbildenden Schulsystem 133
4.7.1 Annahmen zum Kompetenzgefüge 133
4.7.2 Generelle Kompetenzbereiche für die ökonomische Bildung 137
4.7.3 Kompetenzbereiche im Einzelnen 137
4.8 Zusammenfassung 140
5. Gesellschaftliche Herausforderungen und ökonomische Bildung 143
5.1 Die Ausgangssituation 144
5.2 Berufs- und Studienorientierung 146
5.3 Entrepreneurship-Erziehung: Schulische Notwendigkeit oder didaktische Mode? 154
5.4 Finanzielle Allgemeinbildung und Verbraucherbildung 160
5.5 Energiebildung und Klimawandel 167
5.5.1 Die Ausgangssituation 167
5.5.2 Bildungs- und Aufklärungsarbeit 168
5.5.3 Curriculare Folgerungen 171
5.5.4 Gestaltung der schulischen Rahmenbedingungen 173
5.5.5 Implementation der Energiebildung unter ökonomischer Perspektive: Aufbau eines internetgestützten Qualifizierungs- und Informationssystems im Nordwesten (Bundesland Niedersachsen) 174
5.6 Ethik und ökonomische Bildung 174
5.6.1 Das Ausgangsproblem 174
5.6.2 Fachdidaktische Einordnungen 175
5.6.3 Argumentationslinie zum Verhältnis von Individual- und Ordnungsethik 177
5.7 Das Qualifizierungsproblem 181
5.7.1 Lehrerausbildung und Qualität des Unterrichts 182
5.7.2 Lehrerausbildung für die ökonomische Bildung 187
5.7.3 Grundbausteine und Wahlbausteine (fachwissenschaftliche und fachdidaktische Dimensionen) 189
5.7.4 Fort- und Weiterbildung 192
5.8 Zusammenfassung 195
6. Methodik und Implikationszusammenhang von Zielen, Inhalten und Lernverfahrensentscheidungen 199
6.1 Methodik und Implikationszusammenhang 201
6.2 Aspekte des Implikationstheorems 205
6.2.1 Zweck-Mittel-Problematik 205
6.2.2 Forschung und konzeptuelle Systeme 206
6.3 Annahmen zu Lehr-Lern-Konzepten 208
6.3.1 Erkenntnistheoretische Basis der lerntheoretischen Dimension handlungsorientierten Lernens 208
6.3.2 Klassifizierungsprobleme von Methoden 212
6.4 Kognitive Aktivierung 217
6.4.1 Die kognitive Aktivierung als fachdidaktische Herausforderung 217
6.4.2 Unterschiedliche curriculare Ausgangssituationen in den Bundesländern 222
6.4.3 Generelle Ansatzpunkte zur Förderung der kognitiven Aktivierung 224
6.4.4 Schulbuch – didaktische Funktionen 229
6.4.5 Beispiel: Das Fach Wirtschaft in Niedersachsen als Referenzsystem für eine Schulbuchkonzeption 238
6.4.6 Schulbuch und kognitive Aktivierung – ein Widerspruch? 240
6.4.7 Beispiele für aktive Lehr- und Lernverfahren 264
6.5 Auszüge aus dem „Kerncurriculum Wirtschaft“ für Niedersachsen (Themenfelder), Sekundarstufe 1 273
6.5.1 Hinweise für die unterrichtliche Arbeit im Fach Wirtschaft für einen Jahrgang 278
6.6 Zusammenfassung 279
7. Diagnostizieren, üben, überprüfen 283
7.1 Lerndiagnostik und Gestaltung von Erfolgskontrollen in der ökonomischen Bildung 284
7.1.1 Lerndiagnostische Grundlagen 284
7.1.2 Problematik der Realisierung einer Lerndiagnostik im Ökonomieunterricht 288
7.2 Erfolgskontrollen im Spannungsfeld der Erfassung von Lernergebnis und Lernprozess 294
7.2.1 Grundlagen für die Gestaltung von Erfolgskontrollen im Ökonomieunterricht 295
7.2.2 Förderung von Lernentwicklungen und Lernkultur im Ökonomieunterricht 303
7.3 Einüben von Kompetenzen im Ökonomieunterricht 307
7.3.1 Grundlagen für die Gestaltung von Übungsprozessen im Unterricht 307
7.3.2 Übung und Kompetenzentwicklung im Ökonomieunterricht 315
7.3.3 Üben mit Lösungsbeispielen zur Förderung problemlösenden Lernens im Ökonomieunterricht 322
7.4 Bewertungshinweise zur Einschätzung von formellen Testverfahren 330
7.4.1 Eine Alltagsherausforderung mit hoher Komplexität 330
7.4.2 Anforderungen und Kriterien zur Erstellung von Testaufgaben 332
7.4.3 Ein Beispiel zur Entwicklung von Testaufgaben im Fach Wirtschaft 334
7.4.4 Ergebnisse der Überprüfung von Testaufgaben 337
7.4.5 Kriterien für die Auswahl von Testverfahren 343
7.4.6 Herausforderungen von Testverfahren 343
7.5 Zusammenfassung 344
8. Materialienangebote für die ökonomische Bildung: Konstruktion und Beurteilung 347
8.1 Unterrichtsplanung und Materialienangebote 348
8.2 Merkmale von Unterrichtsmodellen 352
8.3 Anforderungen an die Konstruktion und Leitfragen für die Selektion von Unterrichtsmaterialien 353
8.4 Gestaltungsanforderungen an Unterrichtsmodelle 355
8.4.1 Erkenntnisleitende Interessen 355
8.4.2 Thematik 355
8.4.3 Fachwissenschaftlicher Kontext 356
8.4.4 Kompetenzen 356
8.4.5 Lernorganisations-/Lernverfahrensentscheidungen 357
8.4.6 Schlüsselstellen und zu vermeidende Lernergebnisse 358
8.4.7 Schülermaterialien 358
8.5 Überlegungen zum didaktischen Design von mehrperspektivischen Materialienangeboten 359
8.5.1 Unterrichtsmodelle und der Ansatz des mehrperspektivischen Unterrichts 360
8.5.2 Würdigung des „mehrperspektivischen“ Ansatzes für die Materialienproduktion 363
8.6 Zusammenfassung 365
9. Wie kommen inhaltliche Innovationen zum Schüler? 369
9.1 Grammatik der Schule 370
9.2 Leitlinien zur Entwicklung und Institutionalisierung der ökonomischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen 378
9.3 Zusammenfassung 382
10. Literaturverzeichnis 384
Stichwortverzeichnis 402
Giới thiệu về tác giả
Prof. Dr. Hans Kaminski ist Leiter am Institut für Ökonomische Bildung gemeinnützige Gmb H (IÖB).